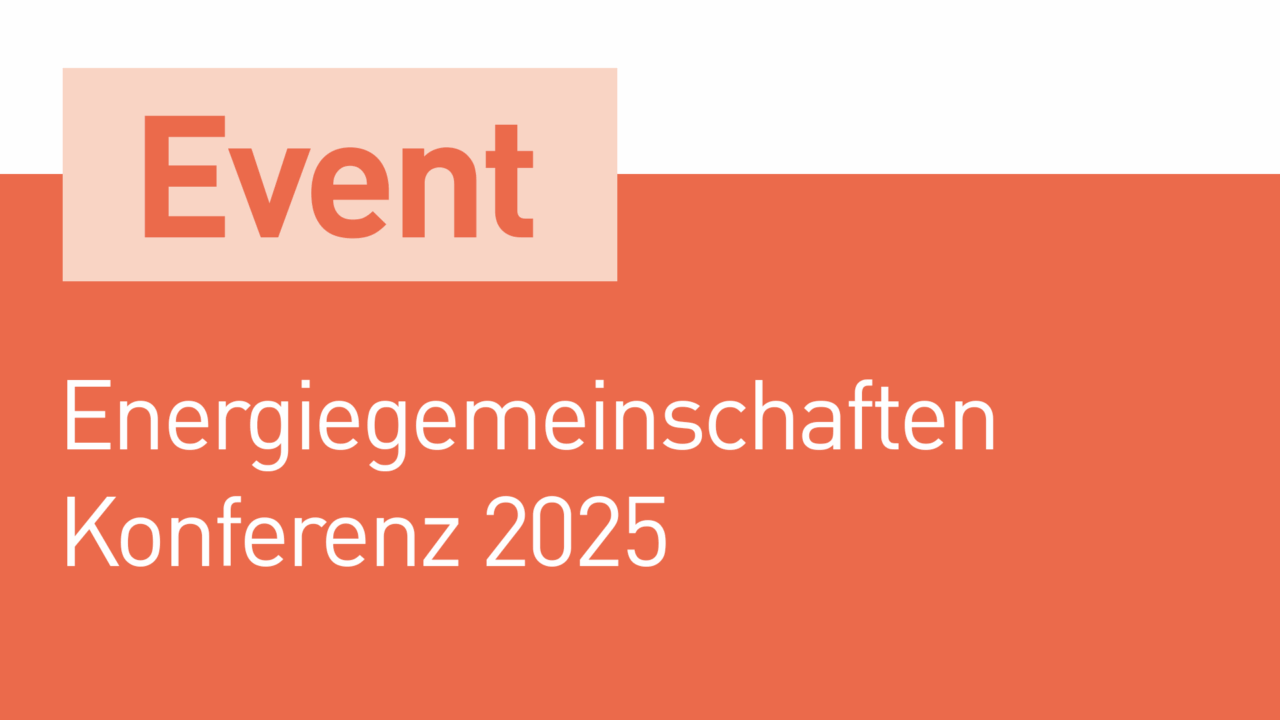Nachlese Energiegemeinschaften-Konferenz 2025
Am 18. September 2025 ging in Wien die dritte Energiegemeinschaften Konferenz der Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften des Klima- und Energiefonds über die Bühne. Im Mittelpunkt standen die stärkere Einbindung von Haushalten und Unternehmen, das Zusammenspiel zwischen Energiegemeinschaften und Energielieferanten sowie die aktuell geplanten Neuerungen im Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG).
Ein vielfältiges Programm mit spannenden Fachvorträgen, Diskussionen und einer Keynote aus der Schweiz bot wertvolle Einblicke und Impulse. Zugleich nutzte die stetig wachsende Community die Konferenz als Plattform für Austausch und Vernetzung.

Begrüßung
Der Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl betonte, wie wichtig es in Krisenzeiten ist, die Chancen zu sehen, die mit Veränderungen einhergehen. Dabei spielen Energiegemeinschaften als neuer Akteur am Energiemarkt eine zentrale Rolle, weil sie die Möglichkeit bieten, die neuen Kräfte, die dem Energiesystem durch die erneuerbaren Energieträger erwachsen, auf intelligente Art und Weise in das System zu integrieren und damit kostengünstige Energie zur Verfügung zu haben und Infrastrukturkosten zu sparen.

Eröffnung
Die Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus Elisabeth Zehetner zeigte die hohe Dynamik bei der Gründung von Energiegemeinschaften auf. Das intelligente Zusammenspiel von Speichern, Last und Einspeisung sowie die datenbasierte Optimierung stehen in Zukunft im Zentrum der Weiterentwicklung.

„Umsetzung von Energy Sharing in der Schweiz“ Jürg Grossen (Schweizer Nationalrat, Swiss Solar)
Jürg Grossen, Präsident von Swissolar und Mitglied des Schweizer Nationalrats, zeigte in seiner Keynote die aktuelle Lage am Schweizer Strommarkt auf und stellte das geplante Energy-Sharing-Konzept für die Schweiz vor, welches 2026 starten soll. Er betonte, dass die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch möglich sei, wenn Effizienz, Digitalisierung und smarte Netze zusammenspielen. Besonders wichtig seien klare Anreize und Geschäftsmodelle, die im Einklang mit der Physik funktionieren.
Seine Botschaft: Lokale Energieproduktion und -nutzung können Versorgungssicherheit erhöhen, Netzausbaukosten reduzieren und den Weg zur klimaneutralen Zukunft ebnen. SmartGridready-Technologien und ein aktives Stromabkommen mit der EU sieht er dabei als Schlüssel für eine sichere und leistbare Energiewende.

„Energiegemeinschaften für leistbare und wettbewerbsfähige Preise nutzen“ Podiumsgespräch
Bei der ersten Podiumsdiskussion sprach Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft, Tourismus und Energie, unter anderem über die Möglichkeiten von Energiegemeinschaften, zur Schaffung planbarer Energiepreise beizutragen, und ihre Fähigkeit, lokale Erzeugung und Verbrauch auszubalancieren. Damit seien Energiegemeinschaften ein Baustein für die Energiezukunft.
Roland Spitzhirn, Geschäftsführer der Eisfabriken Wien, betonte, wie wichtig es sei, Verbraucher:innen für Energiegemeinschaften zu gewinnen, und sieht das Vertrauen in die Energiegemeinschaften und die Kooperationsmöglichkeiten als zentral an, die die Rechtsform einer Genossenschaft mit sich bringen kann.
Sigrid Stagl, Ökonomin an der WU Wien und Wissenschaftlerin des Jahres 2024, sprach über die Einbindung aller Bevölkerungsgruppen. Laut ihr sei wichtig, allen die Möglichkeit zu geben, an einer Energiegemeinschaft teilzunehmen. An der grünen Transformation sollen sich alle beteiligen können, das heißt auch, Narrative für eine positive Energiezukunft in Österreich zu entwickeln und somit die Motivation noch voranzubringen.
Gabriella Dokter, Projektleiterin Armutsprävention bei der Caritas Steiermark, berichtete über Ergebnisse des Forschungsprojekts Sol-E, darunter die eingeschränkten zeitlichen und finanziellen Ressourcen von energiearmen Haushalten bzw. einkommensschwachen Personen. Auch reinen Verbraucher:innen solle die Teilnahme ermöglicht werden, dazu müsse unter anderem Informationen einfacher gestaltet, Vertrauen geschaffen und neue finanzielle Anreize gesetzt bzw. Eintrittshürden minimiert werden.

„4 Jahre Energiegemeinschaften in Österreich – Entwicklungen und aktueller Stand“ Stephan Heidler (ÖKSE)
Stephan Heidler, Leiter der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften, präsentierte beeindruckende Zahlen: Die Zahl der Energiegemeinschaften wächst rasant – mittlerweile sind mehrere Tausend aktiv, mit rund 160.000 Mitgliedern österreichweit. Diese Dynamik zeigt, wie stark das Interesse an gemeinsamer Energieerzeugung und -nutzung steigt.
Weiters zeigte er aktuelle Ausarbeitungen der Arbeitsplattform Energiegemeinschaften, das gemeinsame Informations- und Beratungsprojekt von Bund und Bundesländern: Darunter die Vorstellung einer neuen Plattform, die Energiegemeinschaften leichter mit neuen Mitgliedern zusammenbringen und Privatpersonen den Zugang zu bestehenden Gemeinschaften in ihrer Nähe erleichtert – eine Art “Tinder für Energiegemeinschaften”. Begleitend zum neuen gesetzlichen Rahmen des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) wird die Arbeitsplattform außerdem neue und aktualisierte Musterverträge, Unterlagen und praxisnahe FAQs ausarbeiten, welche wie gewohnt über die Website der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollen. Ergänzt wird dieses Paket durch ein neues Förderprogramm des Klima- und Energiefonds, das Energiegemeinschaften gezielt bei Digitalisierung, Flexibilisierung und Mitgliedergewinnung unterstützen soll und dessen Start noch im Herbst 2025 geplant ist.

„Das ElWG und seine Folgen für Energiegemeinschaften“ Celin Gutschi (BMWET)
Celin Gutschi von der Abteilung Rechtskoordination und Energie Rechtsangelegenheiten des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus stellte in ihrem Vortrag die zentralen Neuerungen der Bürgerenergie im Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) vor und zeigte auf, welche Auswirkungen diese auf Energiegemeinschaften haben. Ziel des Gesetzes sei es, das bestehende Regelwerk zu modernisieren und unionsrechtliche Vorgaben umzusetzen.
Im Fokus steht dabei die neue rechtliche Verankerung der gemeinsamen Energienutzung und der Rolle des Organisators sowie die Klarstellung der Rechte und Pflichten aktiver Kund:innen sowie der Möglichkeit, zukünftig Energie auf Basis von Peer-to-Peer-Verträgen und ohne Gründung einer Rechtspersönlichkeit gemeinschaftlich zu nutzen. Für bestehende Energiegemeinschaften bedeuten die Änderungen sowohl Erleichterungen – beispielsweise bei der derzeit erforderlichen Übertragung der Betriebs- und Verfügungsgewalt über Erzeugungsanlagen – als auch neue Anforderungen wie die Einhaltung bestimmter Lieferantenverpflichtungen ab einer gewissen Anlagengröße.

„15-Minuten-Werte als Basis jeder Energiegemeinschaft – Aktueller und kritischer Blick zum Thema Messwerte und Ersatzwertbildung“ Sabina Eichberger (E-Control)
Sabina Eichberger von der E-Control beleuchtete die Bedeutung von Messdaten für den effizienten Betrieb von Energiegemeinschaften und dem gesamten Stromsystem. Smart Meter und die daraus gewonnenen 15-Minuten-Werte bilden die Grundlage für Abrechnung, Prognosen und Netzsicherheit – und sind damit entscheidend für Transparenz und Fairness innerhalb von Energiegemeinschaften.
Eichberger betonte, dass Datenqualität und -verfügbarkeit zentrale Erfolgsfaktoren sind. Nur wenn Messwerte korrekt und fristgerecht bereitgestellt werden, können Energiegemeinschaften rechtssicher arbeiten und neue Geschäftsmodelle – etwa dynamische Tarife – entstehen. Künftig wird es daher klare Standards, Qualitätsvorgaben und Regelungen zur Ersatzwertbildung geben, die im Zuge des ElWG und weiterer Marktregeln verankert werden sollen.

„Gemeinsame Energienutzung: Welche neuen Anforderungen an Datenflüsse und Marktkommunikation bringt das ElWG?“ Yildiz Tuna (Netz Oberösterreich)
Yildiz Tuna von Österreichs Energie und der Netz Oberösterreich GmbH gab einen tiefen Einblick in die kommenden Veränderungen, die das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) für Datenflüsse und Marktkommunikation für Akteure, die Energie teilen, mit sich bringt. Zentrale Themen sind die Rolle des Organisators, die Anpassungen des Nahebereichs, die Einführung von Schwellenwerten und die Möglichkeit von Peer-to-Peer-Verträgen. Besonders hervorgehoben wurden die Herausforderungen bei Peer-to-Peer-Verträgen sowie die Frage, wie reduzierte Netzentgelte künftig angewendet werden. Klar ist: Standardisierte Marktprozesse und transparente Datenbereitstellung durch Netzbetreiber sind entscheidend, um die gemeinsame Energienutzung effizient und rechtssicher umzusetzen.

„Wie wird‘s morgen?“ Torsten Priebe (Fachhochschule St. Pölten) & Christian Hoffmann (EEG Göttweigblick)
Christian Hofmann und Torsten Priebe haben sich sowohl im Rahmen von Forschungsprojekten in und um die Fachhochschule St. Pölten als auch in der Praxis intensiv mit Energiegemeinschaften auseinandersetzt und zukunftsweisende Lösungen entwickelt. In ihrem Vortrag zeigten die beiden die Potenziale, die die Analyse und intelligente Verarbeitung von Energie- und Wetterdaten für Energiegemeinschaften bergen. Ab einer gewissen Teilnehmer:innenzahl gelingen auch ohne Echtzeitdaten relativ präzise Vorhersagen, die Energiegemeinschaften für die Optimierung des Verbrauchsverhaltens in ihrer Gemeinschaft nutzen können. Künstliche Intelligenz könne dabei behilflich sein.

„Auswirkung von Energiegemeinschaften auf Fahrplanprognose und Ausgleichsenergiekosten von Energieversorgungsunternehmen“ Carolin Monsberger (AIT)
Carolin Monsberger vom AIT Austrian Institute of Technology präsentierte eine aktuelle Analyse zu den Auswirkungen von Energiegemeinschaften auf die Ausgleichsenergiekosten von Energieversorgungsunternehmen. Anhand realer Verbrauchsdaten von Haushalten zeigte sie, dass die Teilnahme an Energiegemeinschaften die Prognosen der Energieversorger beeinflusst und – ohne Anpassungen im Verbrauchsverhalten – zu etwas höheren Ausgleichsenergiekosten führen kann.
Gleichzeitig wird deutlich, dass Speicherlösungen eine Schlüsselrolle spielen können: Sie reduzieren Abweichungen zwischen Prognose und tatsächlichem Energieverbrauch, senken Kosten und stärken den Nutzen von Energiegemeinschaften insgesamt. Monsberger betonte, dass klare Marktprozesse und technische Schnittstellen notwendig seien, um die Integration von Speichern – ob hinter dem Zähler oder als Gemeinschaftsspeicher – effizient zu ermöglichen.

„Spannungsfeld Energieversorgung“ Podiumsgespräch
Im abschließenden Podiumsgespräch wurde intensiv über bestehende und künftige Herausforderungen und die Aufgaben- und Rollenverteilung zwischen Energiegemeinschaften und Energielieferanten diskutiert.
Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der E-Control, zeigte die hohe Gründungsdynamik von Energiegemeinschaften auf, die aktuelle Zahlen der E-Control abbilden, und betonte die wettbewerbsbelebende Rolle von Energiegemeinschaften. Das Modell trägt dazu bei, das energiewirtschaftliche Knowhow der Bevölkerung zu erhöhen.
Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Österreichs Energie, lobte die sachliche Auseinandersetzung der Veranstaltung mit bestehenden Herausforderungen und spricht darüber, wie gut es gelungen ist, Energiegemeinschaften in die Landschaft der österreichischen IT-Prozesse und das Stromsystem zu integrieren. Dabei verdeutlichte sie auch Österreichs Vorreiterrolle als “Energiegemeinschafts-Europameister” in der Europäischen Union. Derzeit dominiere die Diskussion um Energie- und Netzkosten die gesamte Debatte, hier sah sie auch Energiegemeinschaften gefordert mitzuarbeiten, sodass die Kosten im Rahmen bleiben.
Stephan Sharma, Vorsitzender des Vorstands und CEO Burgenland Energie, wurde zur Doppelrolle als Energieversorger und Mitinitiator des Fanclubs Burgenland befragt. Energiegemeinschaften sind seiner Ansicht nach das Zukunftsmodell und bringen eine Art Strommarktrevolution mit sich. Sie ermöglichen, Strom transparent aus den lokalen Erzeugungsanlagen zu den Menschen zu bringen, und erlauben, die Vision zu realisieren, eine gesamte Region klimaneutral und energieunabhängig zu machen. Das Herzstück dieser Veränderung sei die Beteiligung der Menschen an der Transformation und diese gelingt durch langfristig garantierte, günstige Preise.
Peter Eisenschenk, Bürgermeister der Stadtgemeinde Tulln, sprach über die Festlegung der Preise innerhalb der Energiegemeinschaft. Den Rabatt bei den Netztarifen hält er für ein wichtiges Element für die Wirtschaftlichkeit. Die Verquickung der Rolle des Energielieferanten mit der Energiegemeinschaft im Burgenland sieht er kritisch und strich hervor, dass sich der Energieversorger Tulln Energie auf die Rolle als Dienstleister konzentriere.

Links
Pressekontakt